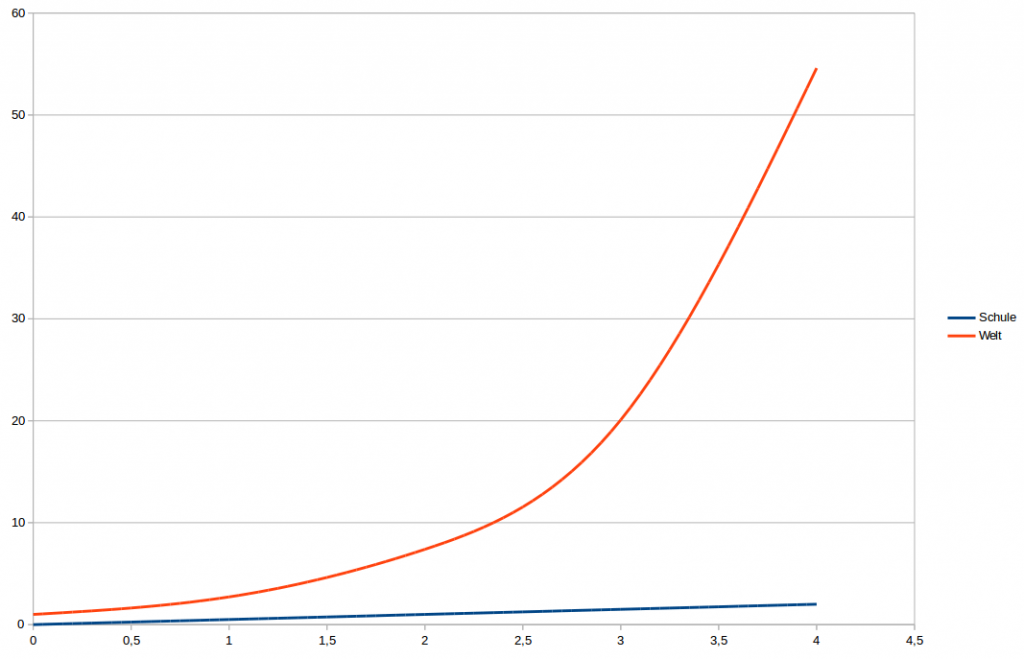Einleitung
Mich machen aktuelle Entwicklungen rund um das Thema Digitalisierung von Schulen nachdenklich. Es sind Themen, die mich in meiner Arbeit unmittelbar betreffen und auch viel Zeit in der Kommunikation kosten.
Das Fach Informatik
Ich habe mich schon mehrfach an diesem Thema abgearbeitet. Ich bin relativ verwundert, wie das Fach Informatik von vielen immer wieder geframed wird. Die mildeste Variante ist die Gleichsetzung von Informatik und Programmieren („Es muss ja nicht jeder Programmierer werden!“). Die kurioseste ist die Unterstellung, das Fach Informatik würde lobbyistisch in Schule positioniert, um verwendbare Arbeitskräfte für den Digitalstandort Deutschland zu gewinnen.
Funfact dabei: Es gibt Forderungen der deutschen Gesellschaft für Informatik aus den 80er Jahren, die sich ziemlich genau mit den Kompetenzbeschreibungen des KMK-Strategiepapiers „Bildung in der digitalen Welt“ decken, das wiederum Vorlage für zahlreiche länderspezifische Kompetenzvorgaben für den Bereich Medienbildung ist. Die Eltern der heutigen Medienkompetenzpapiere sind – überspitzt formuliert – die Informatiker. Informatik und ethische Fragen sind eng miteinander gekoppelt – daher gibt es im Dagstuhl-Dreieck auch die Dimension „Wie wirkt das?“. Ich habe mit Stiftungen zu tun, die informatische Bildung fördern wollen und an Lobbyismusvorwürfen zerschellen.
Bezeichnenderweise kommt viel Kritik von Stiftungen großer Konzerne an der Umsetzung momentanen Kompetenzorientierung an Schulen („Huch? Wie kann das sein, wo doch die Kompetenzorientierung schnell mit wirtschaftlicher Verwendbarkeit gleichgesetzt wird?“). Bezeichnenderweise fordern einige mir bekannte Stiftungen, dass der Staat z.B. Stellen-Kontingente von Beratungsangeboten für Schulen ausbaut und seiner Verantwortung auch z.B. beim schulische Support und bei der Lehrkräftequalifizierung nachkommt. Man fragt, wie und auf welchen Ebenen man helfen kann.
Natürlich besteht in der Wirtschaft ein starkes Interesse an informatisch vorgebildeten Menschen, weil man ansonsten auf anderen Arbeitsmärkten fischen oder Dienstleistung an Cloudanbieter auslagern muss. Dabei geht es auch um die Unabhängigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Aber das ist nur die halbe Miete.
Da erlauben z.B. politische Gremien innerhalb Europas die Fusion von Facebook und WhatsApp, weil konzernseitig „glaubhaft“ versichert wird, dass eine Integration der Daten technisch nahezu unmöglich ist. Mit Grundkenntnissen über Datenstrukturen wäre diese Fehlgriff nicht passiert. Da werden Onlinewahlverfahren als technisch sicher deklariert, wobei es neben der technisch sicheren Abwicklung noch um ganz andere Fragen geht – wie Erfahrungen aus den Niederlanden zeigen. Da nützt auch die Blockchain nichts. Es sind Informatiker, die hier warnen und die Vorzüge der Papierwahl herausstellen.
Es wird für Informatik etwas weichen müssen. Es ist schade, dass andere Stiftungen mit anderen Themengebiete nicht über die Möglichkeit verfügen, im selben Maß Projekte aufzulegen. Es könnte daran liegen, dass das Thema drängt und andere Themengebiete im Bildungssystem bereits länger etabliert sind. Bildungsbürgerlich sind Kunst- oder Musikprojekte natürlich viel charmanter, aber ich mag nicht darüber nachdenken, was durch Bläser- und Streicherklassen die Musikinstrumentenhersteller an Umsatzsteigerungen erzielen.
Für mich sind informatische Grundkenntnisse und Mündigkeit im digitalen Zeitalter sehr eng miteinander verbunden. Medienpädagogische Themen haben eine mindestens ebenso große Bedeutung, werden aber ein wünschenswertes fachliches Niveau verfehlen, wenn sie nicht durch informatische Kenntnisse unterfüttert sind. Ohne die Arbeit unabhängiger Informatiker: Was wüssten wir als Gesellschaft heute wohl über Datenskandale und Datenmissbrauch? Wer Informatik als schulisches Thema bekämpft, wird m.E. vor allen einen immensen Verlust an emanzipatorischer Fähigkeit in der nachfolgenden Generation mit zu verantworten haben. Ich freue mich, wenn ich unrecht behalten sollte.
Lobbyismus
Staatliche Projekte zum Bereich Schule und Digitalisierung stehen zunehmend unter Beobachtung von Lobbygruppen, z.B. Lehrerverbänden – meist aus dem eher linken Spektrum. Über das Informationsfreiheitsgesetz ist es nach rechtlicher Prüfung möglich, tiefere Einblicke in die Genese eines Projektes zu erhalten, vor allem im Bereich der Mittelvergabe oder dem Ausschreibungsmodalitäten. Das ist ein wichtiger Beitrag zu demokratischer Transparenz. Bei den momentan laufenden Verfahren ergeben sich immer rechtlich nicht vollständig abgesicherte Aspekte. Das hat in meiner Wahrnehmung vor allem mit fehlenden Planungskapazitäten und Aufgabenhäufung zu tun – Überlaste Menschen wollen schnelle Lösungen – das kennen wir auch aus anderen Kontexten. Die Fehler, die dabei zwangsläufig entstehen, möchten Lobbyverbände gerne aufdecken und für transparente Prozesse sensibilisieren, damit die Einflüsse kommerzieller Player auf das Schulsystem begrenzt bzw. eingedämmt werden.
Leider geht das komplett schief und mündet letztlich in einer Stärkung genau dieser Einflussnahme Dritter. Aufgeschreckt durch Anfragen dieser Art, ziehen sich staatliche Organisationen aus Kooperationen mit Dritten entweder zurück oder prüfen das weitere Vorgehen. Der Beratungsbedarf an Schulen und bei Trägern – gerade im Kontext des Digitalpaktes – ist immens, ebenso der Fortbildungsbedarf der Lehrkräfte. Da durch den Digitalpakt auch Beratungsleistungen Externer förderfähig sind (so lange sie keine stetigen Begleitmaßnahmen darstellen), werden Träger auf genau diese Angebote zurückgreifen. Da der Bedarf an Fortbildungen an Schulen sehr groß sind, werden sich diese am freien Markt bedienen und die Disfunktionalität staatlicher Organisation beklagen. Das sind keine Hirngespinste – das geschieht nach meiner Wahrnehmung bereits. Zusätzlich wird die Arbeit in diesen Organisationen für kompetente Menschen zunehmend unattraktiv. Da nützen irgendwann auch Aufstockungen von Stellen und Stundendeputaten nichts mehr. Sie müssen mit ansehen, wie andere losgelöst von Verwaltungsvorschriften und Vorgaben Dinge umsetzen, während von ihnen selbst verlangt wird, sich maximal transparent und neutral zu verhalten und dabei bitteschön ganzheitlich und systemisch zu denken. Staatliche Organisationen sind sowieso meist nicht konkurrenzfähig bei der Gewinnung dringend benötigter Fachkräfte.
Gehäufte Anfragen im Zuge des Informationsfreiheitsgesetzes begünstigen und beschleunigen damit paradoxerweise eine Entwicklung, die durch sie im Kern eigentlich verhindert werden soll. Sie sind natürlich objektiv wichtig und demokratisch von Bedeutung.
Die Initiatoren sollten sich darüber im Klaren sein, welche Seiteneffekte durch sie mit ausgelöst werden. Ich bin mir nicht sicher, wie aufgeschlossen Politik in Ländern mit bisher fehlenden Informationsfreiheitsgesetzen sein wird, ein solches voranzutreiben, wenn Anfragen gewisse Detailgrade dauerhaft überschreiten und dadurch immense Personalkapazitäten binden. „Das Schreiben von ein bis zwei Sätzen dauert doch nicht so lange!“ Nein – natürlich nicht, aber dadurch dass man immer einen „offiziellen Status“ einer Auskunft wünscht, hat man als Beifang immer eine Menge juristischer und verwaltungstechnischer Prozesse mit dabei.
Gute Leute haben weiterhin heute im Digitalbereich die Wahl: Sie können sich altruistisch und transparent in staatlichen Organisation engagieren und sich in ständigem Rechtfertigungszwang sehen oder sie können das in kommerziellen Kontexten tun, in denen Geldflüsse nicht transparent gemacht werden müssen und weitaus mehr Freiheiten in der Arbeit bestehen – um den Preis, Nachhaltigkeit wirtschaftlich nicht abbilden zu können. Das darf dann der Staat aufsammeln.
Kritik an digitalen Graswurzelprojekten in Schule
Neulinge, die sich in ihrem Unterricht an digitale Themen heranwagen UND darüber auch noch öffentlich berichten (beides große Schritte!), sehen sich oft Nachfragen ausgesetzt. Ich bin auch so einer, der durch einen schnell rausgehauenen Tweet achtlos jemanden versenken kann. Twitter ist kompliziert, inhomogen und manchmal launig. Auch daran habe ich mich schon abgearbeitet.
Auch ich sehe große Gefahren, dass es bei der Stufe „Technik ahmt das Alte nach bzw. verstärkt es auch noch“ schlicht stehen bleibt, weil uns als Staat noch schlicht die Ressourcen fehlen, weiter zu begleiten und mir als Lehrkraft vielleicht oft der Wille fehlt, nicht „abzuhaken“, sondern prozesshaft mit Zielperspektive dranzubleiben. Technik- und Appschulungen sind nur dann der erste Schritt, wenn im Nachklang weiter reflektiert und begleitet wird.
Wiederholung: Sie verleiten nach meiner Erfahrung ohne weitere (und kommerziell kaum sinnvoll abbildbare) Begleitung dazu, dass das Thema „Digitalisierung“ schnell abgehakt wird – man setzt ja nun Geräte ein und ist deswegen eben digital. Ich rede hier nicht von Leuchttürmern – und auch deren Lampe ist gelegentlich bei genauerem Blick ziemliche trübe – die meisten „guten“ Schulen leuchten nicht nach außen, die machen einfach und konzentrieren sich auf sich.
Technik- und Appschulungen sind aber momentan genau das, was eine breitere Masse leisten kann und was massiv nachgefragt wird (und womit man auch gut Knatter machen kann). Mein Visionszeug erntet heftiges Nicken, so wie in den meisten Kontexten auch die Aussage „Flugreisen sind Mist“ heftiges Nicken ernten würde. Danach den salbungsvollen Worten aus Rieckens Vortrag steigt man vielleicht dann in den Flieger nach Bali oder schreibt sogar (in Einzelfällen!) weiter brav systemgefälliges Substitutionstechnikgedöns in das schuleigene Medienbildungskonzept. Das meint niemand persönlich. Ist halt so.
Bei Kritik gibt es für mich daher immer mehrere Fragen:
- Ist sie logisch und sachlich begründet?
- Wird sie auch auf der Sachebene wahrgenommen?
- Ist sie geeignet, Reflexionsprozesse auszulösen?
Für Kritik ist Kriterium 1 notwendig. Hinreichend wird sie für mich aber erst durch die Kriterien 2 und 3. Wenn man allein auf dem notwendigen Kriterium beharrt, geht es bei der Kritik eben darum, Kritik zu üben und nicht darum, durch Kritik etwas zu verändern. Hart, aber so ist das in meinen Augen heute. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich auch gelegentlich Tendenzen etwas zu benörgeln des Benörgelns willen. Warum ich das tue? – „Guck, mal, was ich kann!“ (Anleihe aus den Känguruh-Apokryphen).
Was alle drei Ansätzen m.E. fehlt
… das ist vernetztes Denken, also ungefähr die Grundlage der 4K. Wir stellen oft unsere Interessen und unsere Themen in den Mittelpunkt ohne das systemische Moment zu sehen. Davon nehme ich mich nicht aus, obwohl mir ja auch gerne unterstellt wird, mich immer als neutral zu inszenieren, es aber im Grunde nicht zu sein. Naja. Dieser Artikel ist ja tendenziell nicht neutral.