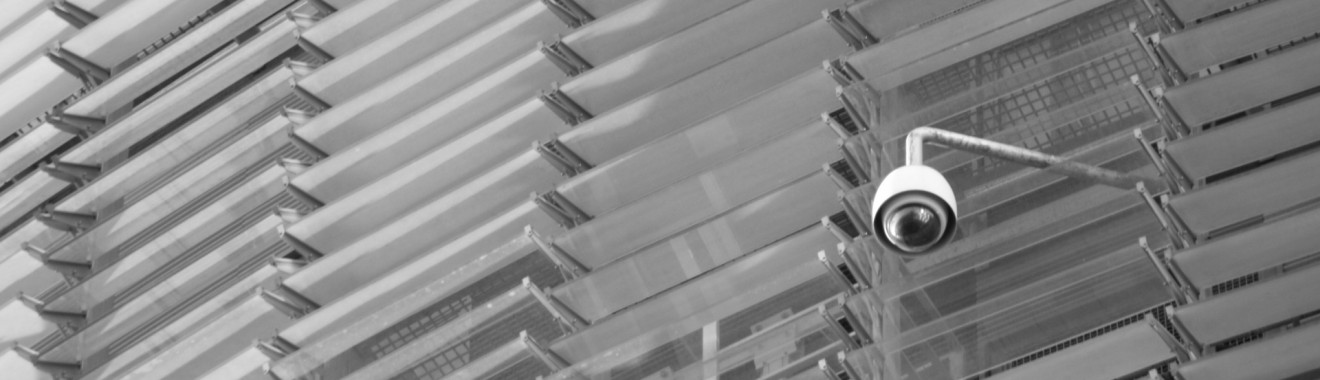Wölfe und Schafe
Was man braucht:
- sieben Reifen, Ringe, Kreise im Sand, in denen eine Person stehen kann
- genau 6 Personen
- viel Geduld und viele Versuche
Wie das geht:
Diese Spiel ist altes Kulturgut aus dem fernen Orient. Jussuph, ein stattlicher junger Mann, hielt um die Hand der schönen Suleika an: Selbige war jedoch eine anspruchsvolle, kluge Frau, die nicht so sehr auf das Aussehen und den Stand des Mannes, sondern vielmehr auf seine Intelligenz achtete. Sie stellte jedem Bewerber drei Aufgaben. Wenn er diese lösen konnte, so wäre sie sein, wenn nicht – Kopf ab! Eine dieser Aufgabe war die folgende:
Im elterlichen Stall befanden sich sieben Tierboxen. Es befanden sich in den drei rechten drei Schafe (S) und in den drei linken Boxen drei Wölfe (W). Jede Box war verschließbar. Die Box in der Mitte war frei (F).
Die Grundstellung ist also: W – W – W – F – S – S – S
Die Aufgabe von Jussuph bestand nun darin, die Schafe in die drei linken und die Wölfe in die drei rechten Boxen zu führen.
Die gewünschte Endstellung: S – S – S – F – W – W – W
Die Regeln:
– kein Wolf darf mit zu einem Schaf in die Box
– kein Wolf darf mit einem Wolf und kein Schaf mit einem Schaf in eine Box
– jedes Tier kann eine Box vor- oder zurückgeführt werden
– es darf über eine Box vor- oder ‚zurückgesprungen‘ werden
– das gilt jedoch nur, wenn die Box mit einem anderen Tier als das springende besetzt ist
Bsp.:
W – W – S – F – W – S – S ===> Zug W – F – S – W – W – S – S ist erlaubt.
W – W – F – W – S – S – S ===> Zug F – W – W – W – S – S – S ist nicht erlaubt.
Drei Leute aus der Gruppe sind nun die Schafe und drei die Wölfe. Die Ringe werden in eine Reihe gelegt und die Grundstellung eingenommen. Aufgabe der Gruppe ist es nun, die ‚Endstellung‘ gemäß der obigen Regeln zu erreichen.
Erfahrungen:
Es ist nicht so knifflig, wie es auf den ersten Blick erscheint und macht eigentlich viel Spaß. So es denn wider Erwarten (die Aufgabe ist zu lösen s.u.) nicht klappen, könnt Ihr als Tip verlauten lassen: ‚Achtet auf das dritte Tier‘. Mit welchem Tier dabei angefangen wird, ist egal – die Lösung:
W – W – W – F – S – S – S
W – W – F – W – S – S – S
W – W – S – W – F – S – S
W – W – S – W – S – F – S
W – W – S – F – S – W – S
W – F – S – W – S – W – S
F – W – S – W – S – W – S
S – W – F – W – S – W – S
S – W – S – W – F – W – S
S – W – S – W – S – W – F
S – W – S – W – S – F – W
S – W – S – F – S – W – W
S – F – S – W – S – W – W
S – S – F – W – S – W – W
S – S – S – W – F – W – W
S – S – S – F – W – W – W