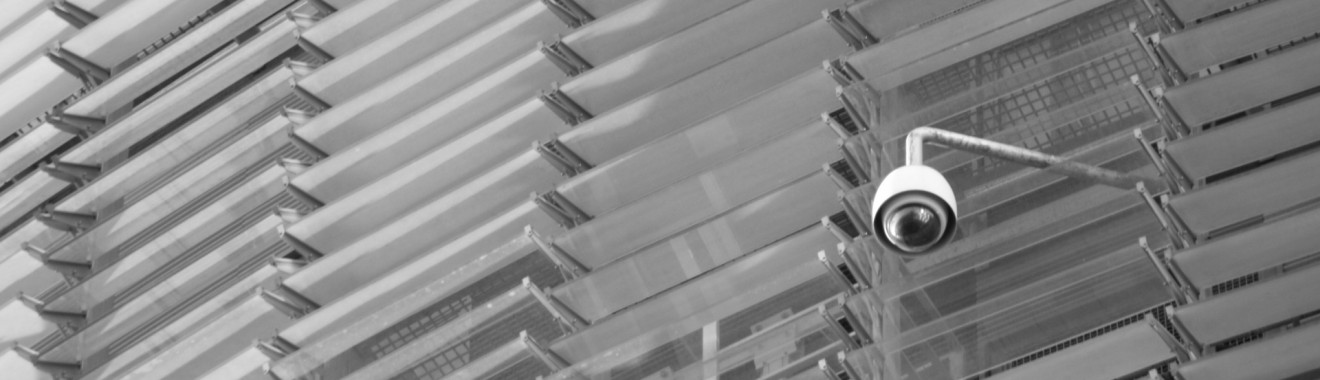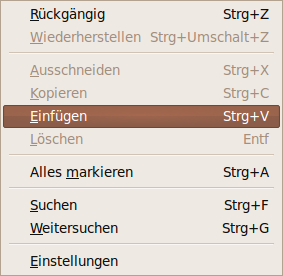… das ist entgegen andersartiger Verlautbarungen aus meinen Berufskreisen durchaus mit einer brauchbaren Trefferquote möglich. Dieser Artikel ist inspiriert durch einen viel ausführlicheren und besseren von Kristian Köhntopp. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit ein kleines Experiment gemacht. Es ging dabei um eine erste Annäherung an einen unbekannten literarischen Text. Die SuS bekamen dazu auf Papier drei Artikel vorgelegt:
- einen Auszug aus dem Kindler (etabliertes Literaturlexikon)
- einen Wikipediaartikel
- einen Beitrag von irgendeiner Webseite
Intuitiv hat bei allen der Kindler gewonnen, obwohl ich Satz und Schriftart bei einen drei Texten angeglichen habe und sie auch alle den gleichen Umfang aufwiesen. Wikipedia folgte auf dem zweiten Rang und weit abgeschlagen rangierte irgendeine Webseite. Intuition ist aber keine objektive Instanz: Dem Kindler darf man glauben, weil es ihn schon so lange gibt und weil er auch in geisteswissenschaftlichen Kreisen als qualitativ brauchbares Werk anerkannt ist. Die statische Webseite wird oft von einer einzigen Person gestaltet, deren Reputation man in der Regel gerade in jungen Jahren schwer einschätzen kann. Wikipedia ist m.E. konzeptionell klassischen Lexika überlegen, weil im besten Fall Inhalte einem evolutionären Prozess der ständigen Veränderung unterworfen sind: Die Artikel werden überarbeitet, diskutiert und mit Belegen ausgestattet. Das einzige Problem ist nur, dass man erkennen muss, in welchem Stadium seiner Evolution sich der jeweilige Wikipediaartikel gerade befindet, während man bei der Neuauflage eines Lexikons in der Regel von einer fachkundigen Revision ausgehen kann. Und das Erkennen funktioniert gerade nicht durch lineare Lesestrukturen, wie sie die Schule primär vermittelt, sondern ganz anders. Daher ein paar Tipps für SuS beim Lesen von Wikipedia:
1. Erst ganz nach unten scrollen
- Sind unter „Literatur“ mehrere Werke angeführt?
- Sind alle Absätze des Artikels einigermaßen gleichmäßig durch Literatur belegt?
- Sind renommierte Nachschlagewerke mit aufgeführt?
- Wie viele Weblinks sind angegeben?
- Enthalten die Links wirklich die angekündigten Informationen?
2. Dann ganz nach oben scrollen
Dort gibt es die beiden Karteireiter „Diskussion“ und „Versionen/Autoren“.
- Sind mehrere Autoren an dem Artikel beteiligt oder nur wenige?
- Haben die beteiligten Autoren schon mehrere Artikel geschrieben?
- Wie viele Aspekte des Artikels wurden wie lange schon diskutiert?
- Wie ist es um die sprachliche Qualität der Diskussionen bestellt?
3. Inhaltsverzeichnis lesen
- Bauen die einzelnen Passagen inhaltlich aufeinander auf?
- Wohnt dem Verzeichnis eine innere Logik inne (z.B. Chronologie), die sich auf den ersten Blick erschließt?
4. Artikel lesen
Durch die ersten drei Schritte, die mit ein wenig Übung gar nicht so lange dauern und die teilweise auch ganz andere Perspektiven beim „richtigen Lesen“ ermöglichen, komme ich eigentlich fast immer sehr gut in das Thema hinein, gerade wenn ich in den „Artikelumweltstudien“ Anknüpfungspunkte zu meinem bestehenden Wissen finde. Ein Restrisiko bleibt immer – strenggenommen aber auch beim Kindler.