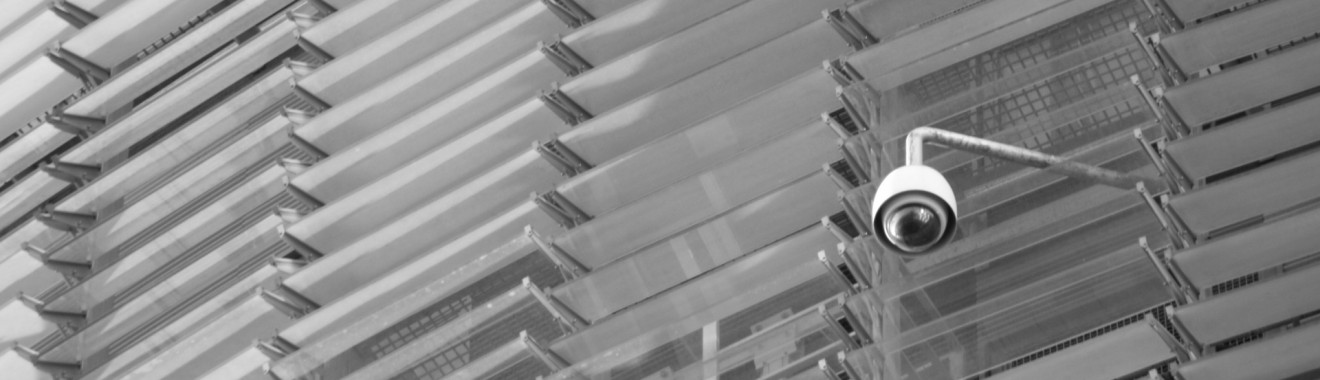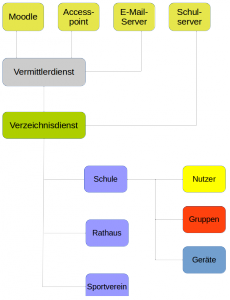In Deutsch auch einmal etwas Vor-schreiben
Auf einem Minitweetup mit Herrn Larbig sind wir irgendwie auf das Problem gestoßen, dass es z.B. in Mathematik oder Chemie üblich ist, Aufgaben oder Übungen durch die Lehrkraft vorzurechnen, um z.B. beispielhaft einen Lösungsweg zu zeigen, der dann bei analogen Aufgaben als Leitfaden dienen kann.
Im Fach Deutsch werden von SuS oft durchstrukturierte Texte verlangt. Im Idealfall übt man an vorgegeben Textbeispielen aus dem Lehrbuch – neuerdings auch mit Überarbeitungsaufgaben, d.h. der schlaue Lehrbuchautor hat im Qualitätsmedium Schulbuch extra ein paar Fehlerchen versteckt.
Wann aber schreiben Deutschlehrkräfte einfach einmal selbst einen Analyseteil, eine Inhaltsangabe oder eine Interpretation und thematisieren ihren Text mit der Lerngruppe?
Häufige Ausflüchte:
- Ich soll ja nichts lernen, sondern die SuS!
- Ich mache mich doch vor der Lerngruppe nicht angreifbar!
- Das dauert doch viel zu lange!
- Dann kann man mich doch festnageln!
- (dann sehen die SuS doch auch meine Unzulänglichkeiten …)
Ich habe mich heute getraut und meinen SuS etwas vor-geschrieben. Es handelte sich dabei um eine Analyse der Erzählhaltung zum Romananfang von „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“. Hier der Auszug:
Indem ich die Feder ergreife, um in völliger Muße und Zurückgezogenheit- gesund übrigens, wenn auch müde, sehr müde (so dass ich wohl nur in kleinen Etappen und unter häufigem Ausruhen werde vorwärts schreiten können), indem ich mich also anschicke, meine Geständnisse in der sauberen und gefälligen Handschrift, die mir eigen ist, dem geduldigen Papier anzuvertrauen, beschleicht mich das flüchtige Bedenken, ob ich diesem geistigen Unternehmen nach Vorbildung und Schule denn auch gewachsen bin. Allein, da alles, was ich mitzuteilen habe, sich meinen eigensten und unmittelbarsten Erfahrungen, Irrtümern und Leidenschaften zusammensetzt und ich also meinen Stoff vollkommen beherrsche, so könnte jener Zweifel höchstens den mir zu Gebote stehenden Takt und Anstand des Ausdrucks betreffen, und in diesen Dingen geben regelmäßige und wohl beendete Studien nach meiner Meinung weit weniger den Ausschlag, als natürliche Begabung und eine gute Kinderstube. An dieser hat es mir nicht gefehlt, denn ich stamme aus feinbürgerlichem, wenn auch liederlichem Hause; mehrere Monate lang standen meine Schwester Olympia und ich unter der Obhut eines Fräuleins aus Vevey, das dann freilich, da sich ein Verhältnis weiblicher Rivalität zwischen ihr und meiner Mutter – und zwar in Beziehung auf meinen Vater – gebildet hatte, das Feld räumen musste; […]
Unsere Villa gehörte zu jenen anmutigen Herrensitzen, die, an sanfte Abhänge gelehnt, den Blick über die Rheinlandschaft beherrschen. Der abfallende Garten war freigebig mit Zwergen, Pizen und allerlei täuschend nachgeahmtem Getier aus Steingut geschmückt; […]
Dies war das Heim, worin ich an einem lauen Regentage des – einem Sonntage übrigens – geboren wurde, und von nun an gedenke ich nicht mehr vorzugreifen, sondern die Zeitfolge sorgfältig zur Richtschnur zu nehmen. Meine Geburt ging, wenn ich recht unterrichtet bin, nur sehr langsam und nicht ohne künstliche Nachhilfe unseres damaligen Hausarztes, Doktor Mecum, vonstatten, und zwar hauptsächlich deshalb, wenn ich jenes frühe und fremde Wesen als »ich« bezeichnen darf – außerordentlich untätig und teilnahmslos dabei verhielt, die Bemühungen meiner Mutter fast gar nicht unterstützte und nicht den mindesten Eifer zeigte, auf eine Welt zu gelangen, die ich später so inständig lieben sollte.(aus: Thomas Mann, Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Der Memoiren erster Teil, Frankfurt/M.: Fischer 1989, S.7–13, gekürzt)
Und hier mein Arbeitsblatt dazu:
| Vorschlag für einen Analysetext | Funktion für die Analyse / Kommentare |
| Der vorliegende kurze Auszug aus dem Roman „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“, geschrieben von Thomas Mann, wird durch die Ich-Perspektive geprägt. | |
| Der fiktive Ich-Erzähler gestaltet stellenweise den zeitlichen Aufbau der Handlung, z.B. wenn er sich selbst zur Räson ruft „nicht mehr vorzugereifen“ (Z.21). Er konstatiert, sich bei seiner eigenen Geburt „untätig und teilnahmslos“ (Z.25) verhalten zu haben. Sich erzählerisch noch in der Vergangenheit befindend, beschreibt er in eine Welt zu gelangen, die er „später so innig lieben sollte“ (Z.27). | |
| Generell verfügt der Ich-Erzähler über detailliertes Wissen zu seiner Umwelt (Z.17 ff.) oder den sozialen Beziehungen innerhalb seiner Familie (Z.14 ff.). | |
| Auch wenn es Textstellen gibt, in denen der Erzähler sehr auf die eigene Person zurückgeworfen ist (Z.2 ff.) überwiegen dennoch die Phasen, in denen er aktiv Einfluss auf das Geschehen nimmt und den Ablauf der Handlung beeinflusst. Seine Werturteile sind geeignet, die Wahrnehmung des Lesers zu lenken. | |
| Klassisch handelt es sich dabei um Elemente einer auktorialen Erzählweise. Der Ich-Erzähler weist in seinem Handeln über sich als Person hinaus und erweckt lediglich die Fiktion des personalen Erzählens. | |
| Dieses im gewissen Maß manipulative Vorgehen des auktorialen Ich-Erzählers lässt sich dem Verhalten eines Hochstaplers zuschreiben. Dies wäre durch eine weitere Analyse des Textes zu prüfen. |
Es kam natürlich die ein oder andere kritische Äußerung, aber es war insgesamt eigentlich gar nicht so schlimm. Die Ergebnisse haben wir kurz ausgewertet, um dann einmal zu versuchen, meine Version als Schablone auf einen anderen Romanauschnitt zu legen. Dieser wies einen eher personal geprägten Ich-Erzähler auf.
Als dritte Stufe (Hausaufgabe) gab es einen Input zu den Begriffen Erzählzeit und erzählte Zeit. Unter diesen Aspekten soll nun wiederum einer der beiden Romanausschnitte analysiert werden.
Ich habe auch schon einmal eine Kurzgeschichte selbst verfasst und als Klassenarbeitstext gegeben, kam mir dabei aber irgendwie blöd vor. Eigentlich verwunderlich: Immerhin trennen mich nur vier Wochen und eine gepimpte Staatsexamensarbeit vom damaligen Magister – da sollte man doch wohl schreiben können …