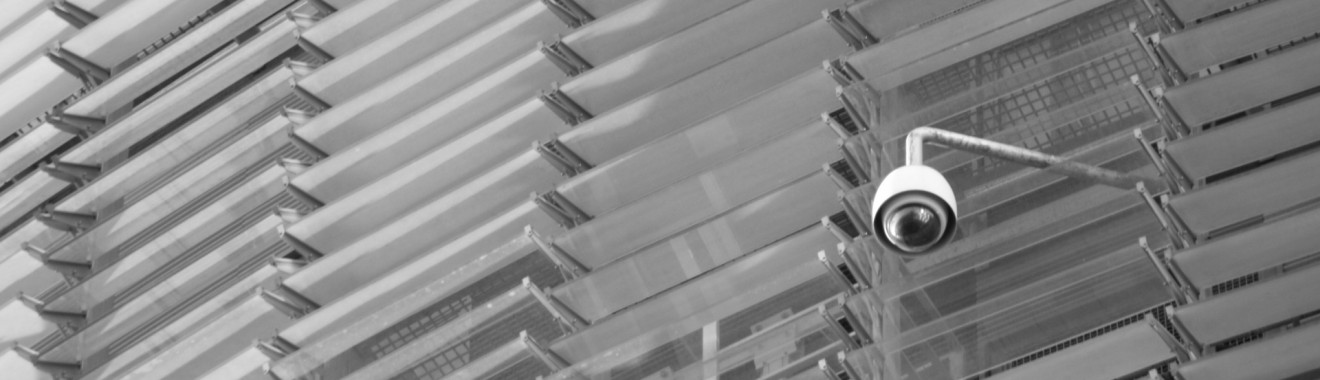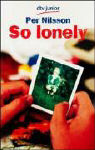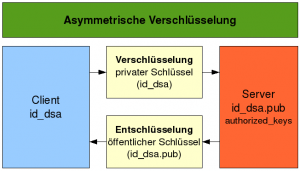Die letzte Welt
Die Schnecken wanden und krümmten sich unter der furchtbaren Wirkung der Säure und stießen zu ihrem Todespfeifen Trauben von Schaum hervor, Schaumblüten, glitzernde, winzige Blasen. Dann fielen die Tiere sterbend ab, stürzten, glitten, rann umarmt den Stein hinab und gaben ihn frei.
Dieser Auszug aus Christoph Ransmayrs Roman „Die letzte“ Welt stellt stellverstretend für ein Grundprinzip des Textes: Des Ästhetisierung des Hässlichen. Damit und auf vielen anderen Schauplätzen spielt dieser postmoderne Roman auf oftmals wundervolle Weise mit dem Gegensatz von Realismus und Idealismus. Ganz natürlich hat in diesem Roman das Hässliche, das Gewöhnliche seinen festen Platz und seine Berechtigung, wie auch z.B. im Naturalismus. Ganz natürlich wird dieses Hässliche in der Tradition idealistischer Sprachkunst, idealistischer Rhetorik ästhetisiert. Somit muss der Text aus beiden Positionen heraus absolut absurd wirken.
Der römische Dichter Ovid wird in das abgelegene, dunkle, archaische Tomi in die Verbannung geschickt. Cotta, ein junger Römer wandelt wenige Zeit später auf den Spuren des nunmehr verschwundenen Dichters. Dabei muss er feststellen, dass sich die ihn umgebende Welt verändert. Nach und nach keimt in ihm die unbewusste Ahnung, dass sich an diesem Ort „Tomi“ alle Merkwürdigkeit von Ovids Metamorphosen realisiert und damit Wirklichkeit und Fiktion auf nicht nur angenehme Weise miteinander verschwimmen. Dabei spannt Ransmayr ein Geflecht aus Symbolen und immer wieder aufgenommenen Bildern, bei dem am Schluss kaum ein Faden heraushängt. Der Text irritiert durch moderne Elemente in einer antiken Welt: So verkehren BUsse oder ein Filmvorfüher erfreut sein Publikum mit Hilfe eines elektrischen Projektors.
Ransmayr hebt damit die Gesetze traditioneller Erzähltechnik aus. Der Text befremdet einerseits auf ganzer Linie und anderseits liefert er eine Fülle von Ansatzpunkten für die gelungene „Küreinheit“ innerhalb eines Deutschleistungskurses, denn ohne ein gewisses Maß an epochaler – und jetzt ganz neu anwendbarer – Vorbildung und lesetechnischer Leidensfähigkeit wird kein Schüler den beschwerlichen Weg dieses Werkes mitgehen oder sich auch nur produktiv an ihm reiben können.