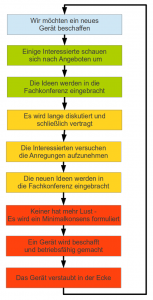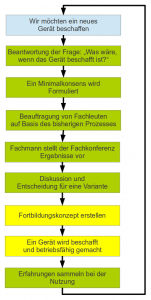Schöne neue dokumentierte Schülerwelt
Hausaufgaben? Sammle ich oft mit pseudonymisierten und nicht öffentlichen Blogs ein. Das hat entscheidende Vorteile:
- Ich weiß schon am Abend vorher, welche Fehlerschwerpunkte in der Lerngruppe auftreten und kann für die Stunde gezielt Übungsmaterial zusammenstellen.
- Durch das Blog bin ich nicht an Dateiformate gebunden und kann querlesen – endlich kein x‑faches Geklicke mehr in der Hoffnung, dass meine Textverarbeitung das aktuelle Microsoftformat frisst.
- Durch den Beitragszähler bei den Autorennamen weiß ich ganz genau, wer in welchem Umfang gearbeitet, bzw. die Hausaufgabe überhaupt erledigt hat.
- Gerade für stillere SuS ist von Vorteil, dass ihre Leistungen dokumentiert sind und für die Benotung der „sonstigen Leistung“ mit herangezogen werden können. So wird niemand dafür „bestraft“ im Unterricht still zu sein.
- Durch die Sortierung nach Autoren entstehen nach und nach Portfolios, die auch dabei helfen, SuS Entwicklungen in ihren Schreibfertigkeiten aufzuzeigen.
Herr Riecken, zu Ihrer Bloggerei mit uns, muss ich Ihnen mal ein paar Dinge sagen. Immer wenn ich eine Hausaufgabe innerhalb des Blogs erledige, fühle ich mich genötigt, das besonders zeitaufwendig und gut zu machen, weil es eben für immer und ewig dort stehenbleibt. Das kostet mich Zeit und ist im Vergleich zum normalen Heft einfach unglaublich aufwändig. Außerdem werde ich ja immer „erwischt“, wenn ich etwas nicht erledigt habe. In einer normalen Unterrichtsstunde kann ich hoffen, einfach nicht dranzukommen – es gibt neben den ganzen Hausaufgaben schließlich immer noch sowas wie ein Leben – gerade in Zeiten von G8. Zu dieser ganzen Portfolio- und „Sonstige Leistungen“-Geschichte: Machen Sie das mit allen Ihren SuS? Um Klausuren zu korrigieren, brauche Sie doch jetzt schon eher Wochen als Tage. Sie schauen sich ernsthaft für alle Ihre Schülernnen und Schüler die „Schreibentwicklung“ an? Hallo? Wachen Sie mal auf und kommen Sie in der Realität an. Kriegen Sie mal Ihre tägliche Verwaltungsarbeit in den Griff, bevor Sie hier Ihr Traumtänzerzeug mit uns machen!
Hinweis: Diese Äußerung ist fiktiv und erdacht!
Also diese Lernplattformen – einfach Klasse. Was da alles mit möglich wird! Wenn man ein richtiges Konzept besitzt, dann…
- können wir von der Grundschule an für die weitere Schullaufbahn dokumentieren, welche Inhalte schon behandelt worden sind.
- erhalte ich durch standardisierte Testaufgaben individualierte Rückmeldungen zu den Stärken und Schwächen der einzelnen Schülerinnen und Schüler
- kann ich exploratives Verhalten im Netz (Chat, Blog, Wiki usw.) in einem Schutzraum entwickeln, das ist gerade für jüngere SuS wichtig.
- entsteht strukturiert über die Jahre ein Portfolio, welches mir hilft, auf individuelle Entwicklungen einzugehen
- werden durch die Arbeit in der Plattform alle Mitglieder einer Lerngruppe gleichermaßen aktiviert, da ja alle arbeiten und niemand sich entziehen kann.
Herr Riecken – haben Sie sich eigentlich schonmal gefragt, ob ich ständig „aktiviert“ sein will? Also wenn alle LuL mit Ihrem Ansatz arbeiten, bin ich nach 90 Minuten echt durch mit der Welt. Soviel „Aktivierung“ hält doch niemand über einen Schultag aus. Kann ich bei der Arbeit mit einer Lernplattform aus dem Fenster schauen? Kann ich auch mal „abschalten“, ohne dass das gleich „dokumentiert“ wird, weil mein Text vielleicht im Vergleich zu anderen viel zu kurz ist? Außerdem schäme ich mich manchmal auch meiner Produkte: Ich kann es einfach nicht besser und es hilft mir dann nicht, dass ich zum xten-Mal sehe, dass Josephine schon wieder den Vogel mit ihrem Produkt abgeschossen hat. Meinen Werdegang in einer Lernplattform dokumentieren, damit Sie wissen, was ich schon alles gemacht habe? Ich will nicht, dass Sie das wissen. Und wissen Sie auch warum? Nur weil da steht, dass schon etwas behandelt worden ist, ist es doch noch lange nicht von mir verstanden worden. Ich will, dass Sie es mir noch einmal erklären – nicht weil Sie lesen, dass z.B. meine Berichte schon immer großer Mist waren, sondern weil Sie mein ehrlich fragendes Gesicht im Unterricht sehen. Ich will, dass Sie mich sehen und nicht meine „Statistiken“ und „Klickraten“ und „Besuchs- und Bearbeitungszeiten. Auf dieses E‑Learningzeug habe ich oft genauso wenig Bock wie auf diese blöden Lektüren. Beides ist halt Schule – nur eben einmal Schule auf dem Computer. Meinen Sie, dass ich das nicht sehr bald raffe?
Hinweis: Diese Äußerung ist fiktiv und erdacht!
Und raus aus der literarische Aufarbeitung des Themas:
- Wie viele Stimmen von Lernenden höre wir, wenn wir über Blogs, Wikis und Lernplattformen in z.B. Fachforen diskutieren?
- Welche Interessen haben wir und welche Interessen haben die Lernenden?
- Wie bewältigen wir unseren Anspruch, z.B. den Aufbau, die Begleitung und die Bewertung von Portfolios?
- Wie können wir unseren Ansprüchen, die wir im Kontext von Blog‑, Wiki- und Lernplattformarbeit im Kontext des bestehenden Systems genügen?
- Mit welchem Eindruck verlassen Lernende unsere Lerngruppen nach der Web2.0‑Arbeit?
- Wie bekommen wir den „Mehrwert“ auch für die meisten Lernenden transportiert?
- Welche Interessen und Motivation leiten uns neben dem Willen nach qualitativer Verbesserung von Unterricht?
- Welche „heimlichen“ Hoffnungen gibt es bei uns in diesem Kontext?