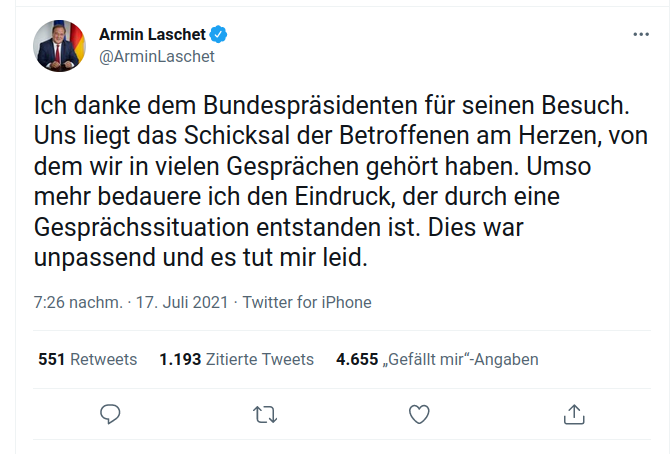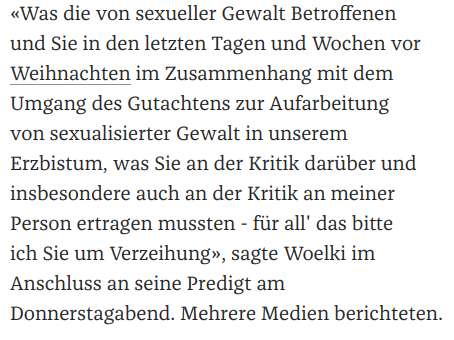Twitter mit Institutionsaccount (na, so halb)
Transparenzdisclaimer:
Dieser Artikel schlummert seit etwa drei Monaten als Entwurf im Blog. Ich habe ihn jetzt herausgeholt, weil die Konflikte im Twitterlehrer:innenzimmer jetzt wieder an einer Stelle sind, an der sie schon vor drei Monaten waren und in drei Monaten wieder sein werden. Ihr werdet das Alter des Artikels an Entwicklungen merken, die schon jetzt nach drei Monaten wieder weitgehend Geschichte sind.
Und los:
Ich vergesse jedes Jahr wieder, dass Konflikte auf Twitter unter verschiedenen Gruppen enorm eskalieren. Eigentlich müsste man jedes Jahr im November (und in Pandemiejahren wohl zusätzlich vor den Sommerferien) eine entsprechende Warnmeldung herausgeben.
Ich will nicht mehr emotional in diesen Strudel gezogen werden – den persönlichen Account hatte ich schon im Spätsommer 2019 aufgegeben. Jetzt versuche ich es mit einem „Institutions“-Account, der bei Lichte besehen eigentlich keiner ist.
Zeit, einmal ein Resümée zu ziehen:
- Es gelingt mir gut, mich aus öffentlichen Metadiskussionen herauszuhalten. Ich verwende diese Energie für Dinge, die ich für nachhaltiger halte, z.B. für die lokale Vernetzung.
- Ich fühle mich darin bestärkt, dass es ab einer bestimmten Reichweite sehr schwierig wird, einen vorher abgesteckten Kurs zu halten. Es gibt Effekte, die man nicht leicht handeln kann, z.B. den Umgang mit Öffentlichkeit. Viel Aufmerksamkeit bedeutet viel Stress und zieht Kraft. Ich bin z.B. niemand, der es genießen kann, viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Tatsächlich habe ich immer wieder Kontakt zu z.B. Journalisten, gebe da aber eher Tipps zu Kontakten oder Ansatzpunkten. Das ist eine Form von Aufmerksamkeit, die ich ehrlicherweise sehr genieße. Und: Ich habe tatsächlich die Forenreaktion auf Heise Online im Kontext eines Artikels relativ unbeeindruckt überstanden. Da kann man jetzt Schritt für Schritt mutiger werden.
- Ich fühle mich darin bestärkt, dass es sehr schwierig ist, ab einer bestimmten Reichweite nicht Versuchungen zu erliegen, z.B. Posts danach vorzufiltern, wieviel Reichweite sie womöglich erzeugen.
- Es ist eigentlich meine erklärte Absicht, Twitter als Baustein für eine mehr lokalere Vernetzungsstrategie zu nutzen, um z.B. Lehrkräfte aus Niedersachsen gezielter anzusprechen. Das kollidiert natürlich mit der regionalen Ungebundenheit von Twitter. Allerdings ist momentan das Interesse an Angeboten zu Digikrams so groß, dass schon der Eintrag in die Veranstaltungsbank des Landes reicht, um Fortbildungen an Teilgeber:innen zu bringen.
- Twitter hat für die „Magie“ hinter Veränderungsprozessen keinerlei Relevanz. Die passiert ganz woanders, z.B. hier in Niedersachsen bei einer zunehmenden Vernetzungen von Beratungssystemen über Institutionsgrenzen hinweg. Das ist übrigens recht harte Arbeit, umso härter, je exponierter die eigene Position im System ist. Auch diese Exponierung vermeide ich noch. Daran wird in der Zukunft noch zu arbeiten sein.
- Twitter spielt für die Hilfe im Alltag untereinander eine immense Rolle. Das funktioniert am allerbesten über zusätzliche Bindungen auf anderen Kanälen. Die Wohlfühlblasen sind für Außenstehende oft weder wirklich zugänglich noch ohne weiteren Kontext überhaupt verstehbar. Gleichzeitig bieten sie aber einen unglaublichen Reiz, dass man sie z.B. aus theoretischen Überlegungen heraus kritisiert, z.B. weil man den Einsatz eines bestimmten Tools aus dem eigenen Verständnis von Digitalität bewertet bzw. „differenziert und kritisch diskutieren will“. Das war z.B. meine große Falle, in die ich jahrelang getappt bin.
Das Konzept der intendierten Öffentlichkeit aus Konfliktauslöser
Philippe Wampfler hat in einem anderen Kontext auf das Konzept der intendierten Öffentlichkeit von Anil Dash hingewiesen. Ich glaube, dass darin der erste Schlüssel für viele Konflikte liegt.
Ein gar nicht so konstruiertes Beispiel, wovon für mich immer wieder Initialzündungen ausgehen:
Wenn ich darauf stolz bin, ein Tool eingesetzt zu haben, besteht die Möglichkeit, dass ich nicht „kritisch hinterfragt“ werden möchte, sondern meine Erfahrungen nur in einem bestimmten Adressatenkreis weitergeben zu wollen. Dass mir z.B. Bildungsinteressierte oder Didaktiker folgen, wird mir u.U. erst im Prozess deutlich.
Die Kritik und die Rückfragen von Außenstehenden müssen darüber hinaus einen bestimmten Kontext konstruieren (wohlwollend oder z.b. kritisch) – für etwas anderes ist Twitter generell zu begrenzt. Die Beurteilung des Gegenübers z.B. auf Basis eines isolierten Tweets ist für mich mit der journalistischen Situation vergleichbar, in der Zitate aus dem Zusammenhang gerissen werden, um einen bestimmten Frame zu setzen – nur tun das die Tweetenden in ironischer Weise im Prinzip ja durch den Tweet selbst.
Tiefgreifende Diskussionen führt man nicht auf 240-Zeichen – der neue Trend ist ja auch „Ein Thread“ (quasi das Pendant der Sprachnachricht auf Twitter). Der Einsatz eines Tools im Unterricht in seinem Kontext kann ja nicht öffentlich sein, sich aber dadurch durchaus relativieren.
Jemandem, der sich schon lange auf Socialmedia bewegt, sind die Dynamiken von Onlinekommunikation bewusst. Die „alten Hasen“ kennen teilweise auch die Geschichte hinter der Geschichte. Neulinge nicht. Das wird leicht vergessen. Der Grad zwischen der Zuschreibung von „mangelnder Kritikfähigkeit“ und „Überforderung“ ist schmal. „Das ist doch hier schon 100mal widerlegt/geklärt/diskutiert worden!“ halte ich für einen Ausdruck dieser Asymmetrie.
Und die ideellen Machtverhältnisse sind nicht nur dadurch asymmetrisch. Auf Twitter und speziell im Twitterlehrer:innenzimmer sind nicht alle „gleich“ und „auf Augenhöhe“. Das ist in meinen Augen eine romantische und naive Webfantasie. Dahinter steckt vielleicht vielmehr der Wunsch nach einer Plattform oder Kommunikationsebene, auf der es so empfunden wird.
Asymmetrische Machtverhältnisse konnten historisch schon immer allein durch Solidarität und Gruppenbildung ausgeglichen werden. Das geschieht auf Twitter. Es wird sich in dem Maße verstärken, in dem asymmetrische Machtverhältnisse ignoriert bzw. wegromantisiert werden. Es sind definitiv nicht alle gleich. Gefordert sind hier vor allem die ideell Mächtigen – zunehmend aber auch im Aushalten persönlicher Angriffe.
Wirklich große Accounts wie der von in diesem Jahr wirklich präsenten Verena Pausder lächeln das nach anfänglicher Verwirrung weg. Da stehen oft ein Team und gewisse Marketingressourcen zur Reichweitenerhöhung zur Seite
Als wäre das nicht schon kompliziert genug
Mit Digitalität und Schule lässt sich Geld verdienen. Um Geld verdienen zu können, braucht es Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit an sich ist auf Socialmedia eine begrenzte Ressource und eigentlich auch sowas wie Geld. Geld und Aufmerksamkeit verdient man momentan nicht mit Entwürfen einer reformierten Schule. Man verdient es mit Inhalten und Materialien, die den Bedürfnissen des Systems Schule jetzt und hier maximal entgegenkommen. Fragt man Verlage, wie das Verhältnis zwischen „technisierten“ und Printprodukten bei der Wertschöpfung ist, ist die Antwort klar, was viele Lehrkräfte zurzeit immer noch wünschen und kaufen. Das kann mir gefallen oder nicht.
Ich finde immer wieder Parallelen zu den SUV-Verkäufen: Es gibt keine objektiven Gründe, sich einen Stadtpanzer zuzulegen. Kritische Geister hört man sich gerne auf Vortragsabenden zum Klimawandel an – dann hat man ja schon etwas getan. Und die sich sowas wie SUVs nicht leisten können, sind entweder neidisch oder Spaßbremsen. Fertig. Danach steigt man alleine in den eigenen SUV und fährt nach Hause.
Was erreiche ich dadurch einen SUV-Fahrer immer wieder öffentlich kritisch zu hinterfragen? Welche „Dialog“ auf Augenhöhe kann ich erwarten angesichts meiner „moralischen“ / „theoretischen“ oder sonst wie gearteten „Überlegenheit“? Erwarte ich wirklich einen Dialog und möchte ich mich in meiner Argumentation bestätigt sehen? Weiß ich nicht schon, dass das Gegenüber auf der sachlichen Ebene (den emotionalen Aspekt in Diskursen kürzt man lieber raus) wenig entgegenzusetzen hat?
Wenn ich Vorträge an Schulen zu Digitalität halte, ist das im Grunde strukturell sehr ähnlich. Das mache ich mir nichts vor.
Oft gibt es Zustimmung. Oder alle sind recht platt und baff. Nach einer Weile: „Und wie setzen wir das jetzt im Ausbildungsgang x in der Einheit y um?“ Der (mittlerweile still gedachte) Satz „Ja das ist doch ihre Kompetenz als Fachobfrau/-mann!“ hilft da nicht wirklich. Eigentlich stellt er eher bloß.
Deswegen habe ich oben auch geschrieben, dass Twitter für noch recht bedeutungslos bei diesem großen Thema halte. Die Verbindungen vom Bildungsjournalismus zur Lehrkräfteszene auf Twitter ist noch zu schwach. Aber auch diese Stunde wird kommen.
Es geht auf Twitter und überhaupt in sozialen Medien immer um Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit für die Vermarktung von Ideen, Konzepten, Veranstaltungen und Theorien. Meinen „neuen“ Account gibt es allein deshalb. Um Aufmerksamkeit für meine Angebote, die Angebote der Medienberatung und die Medienzentren zu generieren.
Kaffeesatzlesen
Twitter wird sich in diesem Jahr noch stärker segmentieren in Untergruppen. Kommunikation über diese Gruppen wird sich zunehmend verkomplizieren, weil sich die Werte und Kommunikationsbedürfe dieser Gruppen sich immer stärker voneinander unterscheiden werden. Immer weniger neue Kolleg:innen werden dem gewachsen sein und sich u.U. rasch wieder abwenden.