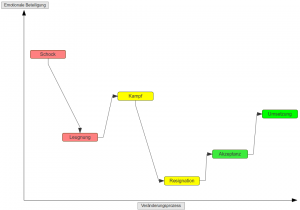Ich habe ein Luxusproblem. Wir als Schule und ich als Berater stehen jetzt allmählich vor der Frage der Endgeräte. Tablets würden z.B. bei uns in der Schule nicht in einen luftleeren Raum fallen, sondern sich in ein vorhandenes Netz integrieren müssen. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu anderen Schulen, die so etwas gar nicht oder nur sehr rudimentär besitzen und daher zwingend auf das Netz der Netze angewiesen (UMTS/LTE) sind oder sich innerhalb von Klassenräumen eigene, meist Applenetze bauen müssen. Unser Netz ist schulweit angelegt und verfügbar. Jeder an der Schule bei uns besitzt:
- Einen eigenen Ordner, der aus dem Schulnetz oder auch über das Internet über eine Vielzahl von Protokollen lesend und schreibend zugänglich ist
- Zugriff auf gemeinsame Verzeichnisse
- Eine vollwertige E‑Mailadresse
- Zugriff auf mehrere Netzdrucker (Man kann sogar von zu Hause aus drucken…)
- Zugriff auf ein flächendeckendes WLAN in der Schule (bald mit Captiveportal)
- Bald Zugriff auf einen Streamingserver (Filme und Audiodateien aus dem Merlinprojekt aufs Endgerät streamen)
- […]
Es gibt Bereiche, die sind für die allermeisten Lehrkräfte Magie – dazu gehört das gerade entstehende Captiveportal zur WLAN-Nutzung oder die WLAN-Router mit bald WPA2-Enterprise und DD-WRT mit ihrer zentralen Steuerung (das könnte man aber auch „bedienbar“ für fast jeden für teures Geld einkaufen). Der größte Bereich ist nicht „magic“, sondern würde auch noch laufen, wenn „Maik morgen vom Bus überfahren wird“ – wie ein Kollege immer gerne argumentativ in Feld führt. Das liegt daran, dass wesentliche Dienstleistungen hier extern eingekaut werden.
Das Netz wird genutzt und die Nutzung steigt kräftig – wie das Monitoring zeigt. Aber auch Art und Umfang der an mich gerichteten Anfragen geben einen guten Einblick darin, was tatsächlich alles schon gemacht wird – vieles wäre noch vor einem halben Jahr völlig undenkbar gewesen.
Kurz gefasst: Das Fundament steht – viele Schulen fangen ja eher mit dem Dach an (Endgeräte). Die Entscheidung für Endgeräte steht bei uns aber jetzt definitiv an. Das ist ein großes Problem für mich, weil Endgeräte sehr teuer im Vergleich zu Netzwerkgeräten sind. Unsere Netzkomponenten kosten umgerechnet auf die Schülerzahl lächerlich wenig.
1:1 Ausstattung ist bei uns zurzeit kein Thema. Dazu muss noch sehr viel in Fortbildung und Akzeptanz investiert werden.
Ich „vermarkte“ unser Netz bewusst nicht, indem ich über soziale Netzwerke jede Neuerung bekanntgebe. Ich möchte dafür erst noch mehr Ressourcen in die Qualifikation aller Beteiligten stecken. Oft kommt sonst nur heraus, dass bisher Analoges jetzt einfach digitalisiert wird. Das ist für mich(!) z.B. dann der Fall, wenn Arbeitsblätter ohne kollaborative Funktionen einfach 1:1 auf einem Tablet abgebildet sind und der Mehrwert eigentlich nur darin besteht, dass das Ergebnis projezierbar ist – das geht auch mit Folien und Dokumentenkameras. Weiterhin ist unsere Schule mit ihrem Netz in Niedersachsen gar nicht so etwas Besonderes – da gibt es einige mehr, die da sogar noch weiter sind. Die Mehrheit der Schulen hat aber auch deutlich(!) weniger.
Die Lage
Die Eduszene ist sich nahezu weltweit einig, dass iOS-Geräte (iPad, iPhone) der didaktische Befreiungsschlag schlechthin sind. Leichte Bedienbarkeit, hervorragende Verarbeitungsqualität, breite App-Auswahl, viele Experimente und Erfahrungen im Unterricht sind Pluspunkte, die Appleprodukte auszeichnen. Stolz sieht man Klasse um Klasse iPads auf Pressefotos in die Höhe halten. Für Schulen, die noch kein eigenes Netz besitzen, ist die Applewelt nach meiner Meinung das Mittel der Wahl – zumindest momentan. Aber einer gewissen Größe und je nach Anforderungen kann es aber auch hier problematisch werden.
Weit im Alltag verbreitet sind Androidgeräte. Mittlerweile ist das Bedienkonzept eigentlich ganz brauchbar, es gibt vernünftige Geräte am Markt und auch die App-Auswahl kann sich mehr und mehr sehen lassen. Aus dem Bildungsbereich liest man wenig über Android. Androids bewegen sich sehr sicher im Netz, da sie sehr gut mit den dort üblichen Standards (CSS, Flash, HTML5) zurechtkommen – kein Wunder, bestimmt doch Tante Google als größter Player auf diesen Terrain kräftig mit. Mich als Techniker nervt die Updatepolitik bei Android – u.U. ist man gezwungen mit einem Gerät zu arbeiten, was nach wenigen Monaten voller Sicherheitslücken ist – in großen Netzen möchte man sowas als Administrator eher nicht sehen – das dürfte auch der Grund dafür sein, dass Android bisher nur im Consumerbereich nennenswert Fuß fassen konnte.
Mit Windows8 gibt es hingegen im Edubereich keine Erfahrungen – weder mit der Verarbeitungsqualität von Geräten, noch mit dem zugegebenermaßen sehr gewöhnungsbedürftigen Bedienkonzept, was Firmen bei Neugeräten mit Windows8 schon zu Downgradelizenzen auf den Vorgänger Windows7 treibt. Hauptargument: Mit einer Tabletoberfläche sei kaum produktives Arbeiten mit Spezialsoftware möglich. Für Schulnetze sehe ich Vorteile: Windows8 lässt sich recht leicht in bestehende Infrastrukturen einbinden (drucken, Einbindung von Netzlaufwerken usw.). Es gibt in den Professionalvarianten von je her Möglichkeiten, Geräte zentral zu steuern und zu verwalten. Für ein neues Gerät muss ich in unserem, Netz etwa 5–10 Minuten meiner Zeit für eine komplette Vorinstallation aufwenden – das dauert bei iOS-Geräten ohne zentrale Verwaltung zur Zeit deutlich länger. Es gibt von je her ein Multiusermanagement. Zusätzlich kann ich zumindest zwei Apps nebeneinander betreiben. Bei den Nicht-RT-Varianten ist das Betriebssystem nicht fest mit dem Endgerät verbunden wie bei Android oder iOS – d.h. wenn einer Linuxdistribution der große Tabletschlag gelingt, kann man z.B. wechseln.
Die fast schon religiös anmutende Aura, mit der Appleprodukte konnotiert sind, können Windows8 und Android nicht transportieren – ich stelle mir gerade vor, wie SuS stolz Win8-RT-Tablets in die Höhe halten – der Spott im Netz würde zum jetzigen Zeitpunkt wohl keine Grenzen kennen.
Was tun?
Ich habe keine Ahnung. Für ein so großes Netz wie das unsere, das im Prinzip eine Vielzahl von Geräten unterstützen würde – mit der Rahmenbedingung, keine Möglichkeiten zu 1:1 Settings zu haben, sprechen angesichts der verfügbaren Ressourcen zur Pflege der Geräte und der Anbindung an vorhandene Arbeitsabläufe zumindest für Schulgeräte alle Argumente für Windows8.
Nutzerakzeptanz würde man viel eher mit iOS-Geräten erhalten („Appleaura“), schafft sich dann aber eine Reihe von Herausforderungen bei Pflege und Verwaltung. Schulen mit rudimentären Netzen haben eigentlich kaum eine sinnvolle Alternative zu iOS (iPad), weil das Netz ja oft deswegen zu rudimentär ist, da die Ressourcen und das Wissen zum Aufbau vor Ort fehlen.
Ich löse das für mich vorerst sehr zurückhaltend mit zwei Sätzen an gebrauchten Subnotebooks für die Gruppen- und AG-Arbeit. Wie wird das eingesetzt? Welche Probleme treten auf? Ist die Bootzeit das entscheidende Problem?